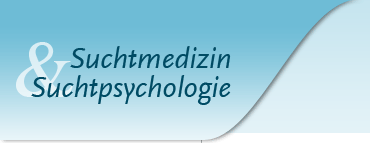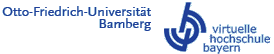Neuroadaption und Suchtgedächtnis
Zwei unterschiedliche Hypothesen werden zur Erklärung der dauerhaften Rückfallgefahr diskutiert:
- Neuroadaptation
- Suchtgedächtnisbildung
Neuroadaptation
Unter diesem Begriff wird kurz gefasst folgender Prozess verstanden: bei Überreizung mit einem exogenen Wirkstoff passt sich die Zelle an und normalisiert ihre Reizantwort. Diese Adaptation kann auch dauerhaft bestehen bleiben.
"Wenn zum Beispiel Hirngewebe immer wieder mit Opiaten überflutet wird, so überlagert sich die Wirkung dieser exogenen Wirkstoffe mit der der endogenen Agonisten am opioiden µ- Rezeptor (vor allem der Endorphine). Zum Teil treten exogene und endogene Effekte auch in Konkurrenz zueinander, da sie einem anderen Konzentrations-Zeit-Schema folgen. An diese Übererregung und den Verlust des endogenen Zeitmusters der Wirkung passen sich die Nervenzellen regulativ an" (Wolffgramm und Heyne, 2008, S.277). Durch diesen Mechanismus schützt sich das Nervengewebe gegen die einseitige Erregung und erreicht dadurch trotz chronischer oder intermittierender Störung seiner Balance einen Status der "Normalität". Problematisch wird es, wenn die Substanz abgesetzt und der Zustand dadurch in Unordnung gerät. Als Folge kommt es zu Störungen von Kontrollfunktionen des Gehirns. Es kann zu physiologischen Dysfunktionen und allgemein dysphorischen Zuständen kommen, die man - abhängig von der Substanzklasse - zusammenfassend als akutes Entzugssyndrom beschreiben kann.
Nach Absetzen der Substanz kann es zu einem Entzugssyndrom kommen.
Werden nun dauerhaft keine Drogen mehr konsumiert, finden neuroadaptive Prozesse statt, deren Ziel es ist, das Gleichgewicht der Neurotransmission zu rekonstituieren. Mit Erreichen dieses Ziels ist der akute Entzug beendet.
Allerdings ist dieses "Zurückschrauben" auf den Ausgangszustand nicht mit allen neuroadaptiven Veränderungen möglich, manche persistieren. Diese "protrahierten" Entzugserscheinungen kommen nach Wolffgramm und Heyne (2008) als Verursacher einer Suchterkrankung in Frage.
Eine derartige "pharmakologische" Deutung von Suchtentstehung wird von manchen Suchtforschern für nicht stichhaltig gehalten. Ihrer Meinung nach spielen Erfahrungen, biografische und soziale Faktoren eine wichtigere Rolle. Das eher "psychologische" Konzept des Suchtgedächtnisses wurde aufgrund klinischer und psychologischer Erfahrungen entwickelt.
Zurückkehren zum Ausgangszustand nicht immer möglich
Biografische und soziale Faktoren
Suchtgedächtnisbildung
Aufgrund einer Erfahrungsbildung, die sich in einer besonderen Form des Gedächtnisses niederschlägt, entsteht nach diesem Konzept Suchtverhalten. Verhaltensmotivation, externe Reizkonstellationen (z.B. "cues", also drogenbezogene Hinweisreize), Vorerwartungen und psychotrope Wirkung lassen sich so assoziativ miteinander verknüpfen. Aufgrund der angenommenen Gedächtnisbildung auf subkortikaler Ebene besteht, im Gegensatz zur Gedächtnisbildung auf kortikaler Ebene, eine "Starrheit" bezüglich Vergessen, Umlernen und Neubildung von Gedächtnisinhalten.
"Ein Konsument psychoaktiver Substanzen sammelt ständig Erfahrungen, die seinen Substanzzugriff und die von diesem ausgelösten Wirkungen Konsequenzen betreffen. Selbst beim Absetzen des Wirkstoffes können neue Erfahrungen, die zum Beispiel den Entzug betreffen, hinzukommen. Welche dieser vielen Erfahrungen führen nun zur Bildung des Suchtgedächtnisses? Die ersten Substanzerfahrungen können es noch nicht sein. Der Konsument lernt die dosisabhängigen Effekte des Wirkstoffs kennen, er erwirbt damit ein "Drogengedächtnis".
Er findet auch heraus, wie er gewünschte Wirkungen optimal über ein geeignetes Zugriffsmuster erzielen kann. Letzteres geschieht über operante Lernprozesse und führt zu einem "Einnahmegedächtnis" (Heyne et al. 2000). Die Konsequenz dieser Gedächtnisbildung ist aber kein süchtiger Substanzzugriff, sondern zunächst ein kontrollierter Substanzgebrauch.
[...] Ein Suchtgedächtnis, welches kaum noch löschbar ist und mit dem Verlust der Selbstkontrolle über die Substanzeinnahme einhergeht, muss sich daher zu einem späteren Zeitpunkt entwickeln." (Wolffgramm und Heyne, 2008, S. 289)
"Einnahmegedächtnis" durch Lernprozesse.
Folgende Hypothesen werden zur Entstehung des Suchtgedächtnisses diskutiert:
- Schleichend kontinuierlicher Verlauf bzw. Bildung in vielen kleinen Schritten mit immer größer werdenden Kontrolleinbußen
- Entstehung in mehreren größeren Entwicklungsschüben ("immer tieferes Abrutschen in die Sucht")
- Übergang vom kontrollierten Substanzgebrauch zum Kontrollverlust in einem einzigen, kaum noch reversiblen Schritt ("point of no return")
Aktuell wird die erste Hypothese am meisten diskutiert. Sie wurde von Robinson und Berridge (1993, 2001, zitiert nach Wolffgramm und Heyne, 2008, S.290) als "Incentive-sensitization-Konzept" beschrieben. Intermittierende Verabreichung bestimmter Substanzen ruft steigende Verhaltensantworten hervor. Diese "Sensitivierung" betrifft zunächst Parameter der motorischen Aktivität aber auch das substanzbezogene Appetenzverhalten steigert sich.
Nach Wolffgramm und Heyne (2008) gibt es überzeugende Hinweise dafür, dass man beim Zugriff auf einen psychoaktiven Wirkstoff zwischen "Mögen" (Repräsentation einer positiven oder negativen Bewertung ohne eigentliche Handlungstendenz) und "Wollen" (Motivation für eigene, gerichtete Aktivität) unterscheiden kann. Durch mehrfache Substanzverabreichung verändert sich das "Mögen" nur wenig, das "Wollen" hingegen sehr stark, der Drang zum Konsum steigert sich mit jeder neuen Substanzerfahrung. Beim kontrollierten Konsumenten sind "Mögen" und "Wollen" weitgehend gekoppelt, beim Suchtpatienten entspricht dagegen dem starken "Wollen" kein gleich starkes "Mögen" mehr.
Den Rückerinnerungen von Suchtpatienten entspricht die zweite Überlegung am Ehesten. Als Auslöser für die Schübe der Suchterkrankung werden belastende Ereignisse angesehen.
Verhältnis von "Mögen" und "Wollen" bei Suchtpatienten
Die dritte genannte Hypothese hat wieder an Aktualität gewonnen, nachdem einige Ergebnisse von Tierversuchen sich nicht mit der ersten Überlegung in Einklang bringen ließen. Es scheint, dass der "Point of no return" das Umschlagen vom moderaten zum exzessiven Konsum markiert. Eine "sensible Phase", in der eine Suchtgedächtnisbildung vorbereitet, aber noch nicht notwendigerweise vollzogen wird, scheint von zentraler Bedeutung zu sein. Innerhalb dieser Phasen ist das Gehirn aufnahmebereit für die betreffenden Verknüpfungen, neurobiologisch findet sich eine selektiv gesteigerte Neuroplastizität. Bislang liegen die Gründe für das plötzliche Entstehen einer für die Suchtgedächtnisbildung sensiblen Phase noch im Dunkeln.
langen Seiten an den Seitenanfang
nach oben zu springen. Klicken Sie hier, um diese
Seite auszudrucken.